Sanierung mit Naturlehm – einfach, selbst, gemeinschaftlich
Das Bauen mit Naturlehm (Grubenlehm) bietet eine einzigartige Verbindung von Tradition, Innovation und Handwerk. Es ermöglicht die Wiederentdeckung vergessener Techniken und die Entwicklung moderner Bauweisen, die umweltfreundlich, wirtschaftlich und nachhaltig sind.
Sanierung eines historischen landwirtschaftlichen Gebäudes
Der Obergrashof ist ein Betrieb mit biologisch-dynamischer Landwirtschaft, der mit den Herausforderungen des strukturellen Wandels konfrontiert ist. Die Remise, einst zur Lagerung von Torf genutzt, stand vor der Frage nach einer neuen Nutzung. Die Sanierung erfolgte mit einem praktischen Ansatz, der eng mit der Hofgemeinschaft verknüpft war. Ziel war es, den Werkstoff Lehm intensiv zu erforschen, zu verarbeiten und seine bautechnische Verwendung praxisnah umzusetzen. Die Baumaßnahmen umfassen das gesamte Gebäude und begannen mit der Beschaffung und Aufbereitung von lokalem Lehmaushub.
Naturlehm als Baustoff: Geologie und Zusammensetzung
Lehm ist ein natürlich vorkommendes Sediment, das sich durch seinen Anteil an Tonmineralen auszeichnet. Diese sorgen für die bindenden Eigenschaften, die für die Verwendung als Baustoff grundlegend sind.
Die Bestandteile von Lehm sind:
- Ton (< 0,002 mm) – das eigentliche Bindemittel
- Schluff (0,002 – 0,063 mm) – verbessert die Struktur
- Sand und Kornanteile (> 0,063 mm) – sorgen für Stabilität
Lehm ist nahezu überall verfügbar, wodurch lange Transportwege reduziert werden. Nach der Nutzung kann das Material rückstandslos in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden. Seine Reversibilität und Schadstofffreiheit machen ihn zu einem idealen Baustoff für nachhaltiges Bauen mit Blick auf den gesamten Lebenszyklus. Einfach gesagt: Jedes Lehmprodukt – am Ende seiner Zeit wieder mit Wasser angereichert – wird plastisch und kann in beliebiger Form zu einem neuen Lehmprodukt weiterverarbeitet werden. Damit ist eine ewiger Materialkreislauf gewährleistet!
Möchten Bauherr*innen Aushubmaterial für Bauzwecke verwenden, müssen einige Themen Beachtung finden:
- Welche geologische Zusammensetzung ist für bestimmte Anwendungen geeignet?
- Handelt es sich um tragende oder nichttragende Bauteile?
- Möchte ich leichte oder schwere Lehmprodukte herstellen?
Beim Obergrashof kam das Ausgangsmaterial aus einem nachträglich ausgebaggerten Keller. Altlasten konnten ausgeschlossen werden. Um es qualitativ einschätzen zu können, habe ich Feld- und Laborprüfungen durchgeführt.
Besonders wichtig war die Analyse der mineralogischen Zusammensetzung, um sicherzustellen, dass der verwendete Lehm eine ausreichende Bindekraft besitzt. Das Ergebnis: Ein magerer Lehm mit hohem Quarz- und Feldspat-Anteil, ideal für den Lehmbau und die Herstellung von Leichtlehm.

Workshop mit einer Montessori-Schule aus Dachau
Grubenlehm, Naturlehm
Auslegen der Leichtlehmsteine zum Lufttrocknen
Leichtlehmsteine beim Lufttrocknen
Fertiggestellte Ausfachung mit Stroh-Leichtlehmsteinen im 3DF Format
Baustellenbesprechung mit Bauherrin und Handwerker. Im Hintergrund fertiggestellte Innendämmung aus Holzweichfaserplatten, sowie fertiggestellte Fehlböden in der bestehenden Holzbalkendecke
Fenster nach Einbau mit Schlagregenschutz und Fensterbrett als Opferbrett aus Lärchenholz
Einfache Feldversuche. Hier Reibe- und Waschversuch
Bautenstand vor Fenstereinbau und Fassadenarbeiten
Bautenstand mit eingebauten Fenstern1 Workshop mit einer Montessori-Schule aus Dachau2 Grubenlehm, Naturlehm3 Auslegen der Leichtlehmsteine zum Lufttrocknen4 Leichtlehmsteine beim Lufttrocknen5 Fertiggestellte Ausfachung mit Stroh-Leichtlehmsteinen im 3DF Format6 Baustellenbesprechung mit Bauherrin und Handwerker. Im Hintergrund fertiggestellte Innendämmung aus Holzweichfaserplatten, sowie fertiggestellte Fehlböden in der bestehenden Holzbalkendecke7 Fenster nach Einbau mit Schlagregenschutz und Fensterbrett als Opferbrett aus Lärchenholz8 Einfache Feldversuche. Hier Reibe- und Waschversuch9 Bautenstand vor Fenstereinbau und Fassadenarbeiten10 Bautenstand mit eingebauten Fenstern
Fachwerk und Lehmbau: Traditionelle Bauweise in zeitgemäßer Anwendung
Fachwerkgebäude bestehen aus einem tragenden Holzskelett, dessen Gefache traditionell z.B. mit Lehm ausgefüllt werden. Ziel am Obergrashof war es, die ursprüngliche Ästhetik zu bewahren und gleichzeitig moderne Anforderungen an Wärmeschutz und Wohnqualität zu erfüllen. Das auf Punktfundamenten ruhende Fachwerk mit Obergeschoss und Dachstuhl benötigt daher eine ausgebaute Hüllfläche für Boden, Wand und Dach. Für die Gefache eignet sich Strohleichtlehm, da er feuchteunempfindlich, frostbeständig und auch wärmedämmende Eigenschaften aufweist. Bei der Rezeptur der Leichtlehmsteine war das Ziel einen in sich stabilen, witterungsbeständigen, frostsicheren und möglichst leichten Lehmstein zu erhalten.
Die Herstellung von in Eigenleistung produzierten Lehmprodukten wurde schrittweise erklärt. So konnten sie von Laienkräften und Kindern selbständig umgesetzt werden. Hergestellt wurden Lehmputze, Lehmschüttungen, Stampflehm und schwere sowie leichte Lehmsteine.
Beispielhaft ist die schrittweise Herstellung von nichttragenden Strohleichtlehmsteinen für die Gefache:
- Erzeugung einer Lehmschlämme
- Erzeugung von Strohhäcksel
- Übergießen der Strohhäcksel mit Lehmschlämme
- Mischen, sodass alle Halme mit Lehm ummantelt sind
- Einschlagen der Leichtlehmsteine in die Lehmsteinformen und Form abziehen
- Vor dem Einbau zwei Wochen mit ausreichender Temperatur und Durchlüftung trocknen lassen.
Entscheidende bauphysikalische Themen für unsere Planung waren Diffusionsoffenheit, Luftdichtigkeit und Feuchteschutz. Alle Bauteile – Boden, Wand, Decke – wurden im Detail diffusionsoffen geplant, wodurch Feuchtigkeit auf natürliche Weise reguliert und abgeführt wird. Dies verhindert Bauschäden an Holzbauteilen, verbessert das Raumklima und erhöht insgesamt die Langlebigkeit des Gebäudes. Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Einbau der Fenster. Statt auf konventionelle Folien und Klebebänder zu setzen, wurde eine luftdichte innere Putzebene mit einem in Lehmschlämme getränktem Vlies realisiert. Die Dämmebene wurde mit Stopfhanf gefüllt und außenseitig ein Schlagregenschutz angebracht, was eine nachhaltige und baubiologische Lösung darstellt.
Naturlehm in der praktischen Anwendung
Die Bauweise mit Naturlehm orientierte sich an einfachen und bewährten Prinzipien. Neben Lehm kamen Materialien wie Holz, Holzweichfaser und Stroh zum Einsatz. Im erdberührten Bereich wurden zusätzlich Glasschaumschotter, gebrannte Ziegel, Jute und Kork verwendet. Ein großer Vorteil von Lehm und anderen Low-Tech-Materialien sind deren einfache Verarbeitung und weshalb sie sich als Baustoffe für den Selbstbau empfehlen. Viele Arbeitsschritte können ohne teure Maschinen, spezielle Schutzkleidung und Fachkräfte ausgeführt werden. Dies erleichtert nicht nur die Finanzierbarkeit, sondern auch den gemeinschaftlichen Bauprozess. Gleichzeitig trug der praktische Umgang mit dem Material dazu bei, ein tiefes Verständnis für dessen Eigenschaften zu entwickeln. Der gemeinsame Bauprozess stärkte das soziale Miteinander auf dem Hof und schafft für alle Beteiligten wunderbare Momente.
Die Verbindung von alten Techniken mit moderner Planung ist innovative und nachhaltige Baukultur. Lehm ist dabei der Baustoff, der Mensch und Natur in Einklang bringen kann.
Baudaten
Sanierung und Nutzungsänderung einer Fachwerkremise in Dachau/Bayern
| Planersteller / Bauleitung | Roman von Dall’Armi |
| Baujahr / Sanierung | um 1900 / seit 2021 |
| Nutzfläche | 686 m² |
| Außenwände | von außen nach innen … Stärke 28 cm | U-Wert ca. 0,85 W/m2K | Sichtfachwerk/Kalkputz | Lehmsteinmauerwerk (Gefache) | Holzweichfaser-Innendämmung | Lehmputz | Jute-Vlies | Lehmfarbe |
| Dach (von außen nach innen) | Dachdeckung (Solardachplatte) | Lattung |Konterlattung (Hinterlüftungsebene) | Holzfaser-Unterdeckplatte | Zwischensparrendämmung flexibler oder loser Holzfaserdämmstoff | Dampfbremse/Luftdichtung | Lattung (Installationsebene) | Lehmbauplatte | Lehmputz |
| Innenwände | Holzständerwand | schwere Lehmsteine | Lehmputz oder Lehmtrockenbau |
| Unterste Geschossdecke (von unten nach oben) | Glasschaumschotter | Vlies | Holzunterkonstruktion | Perliteschüttung | Eichendielen |
| Geschossdecke (von unten nach oben) | Lehmputz auf Holzweichfaserausbauplatte | Holzbalkendecke mit Fehlbodenkonstruktion | schwere Lehmschüttung | Sparschalung | Fußbodenaufbau |
| Fenster, Türen | Holzfenster, Holztüren |
| Heizung | Hochtemperatur Wandheizung |
| Links zur Diplomarbeit | www.netzwerklehm.at www.lehmprojekte.com |
Ihre Stimme zählt
Kommentarregeln:
Wir sind neugierig, was Sie zu sagen haben. Hier ist Raum für Ihre Meinung, Erfahrung, Stellungnahme oder ergänzende Informationen. Bitte beachten Sie bei Ihrem Kommentar folgende Regeln:
- Bitte keine Fragen: Auf dieser kostenlosen Informationsplattform können wir keine Fragen beantworten - bitte stellen Sie Ihre Fragen direkt an unsere Autor*innenAutor*innen.
- Bitte keine Werbung: Gerne können Sie auf Ihre Produkte/Dienstleistungen mit einem Werbebanner aufmerksam machen.

Wie werde ich
Baubiolog*in IBN?
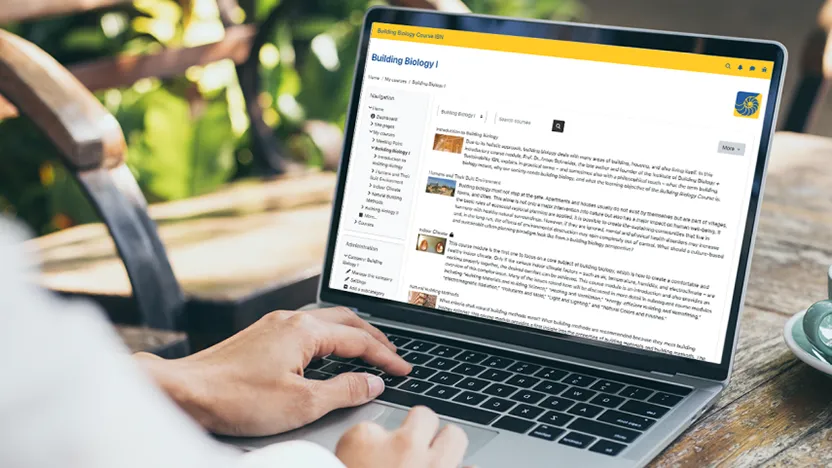
How to become a Building Biology Consultant IBN?
Nachhaltig weiterbilden
Know-how, Zusatzqualifikationen und neue berufliche Möglichkeiten für Baufachleute sowie alle, die sich für gesundes, nachhaltiges Bauen und Wohnen interessieren.
Unser Kompetenz-Netzwerk
Hier finden Sie unsere qualifizierten Baubiologischen Beratungsstellen und Kontakte im In- und Ausland nach Standort und Themen sortiert.
Über die Baubiologie
Die Baubiologie beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Menschen und ihrer gebauten Umwelt. Wie wirken sich Gebäude, Baustoffe und Architektur auf Mensch und Natur aus? Dabei werden ganzheitlich gesundheitliche, nachhaltige und gestalterische Aspekte betrachtet.
25 Leitlinien
Für einen schnellen, aufschlussreichen Überblick haben wir in 25 Leitlinien der Baubiologie die wichtigsten Parameter herausgearbeitet, sortiert und zusammengefasst. In 15 Sprachen, als PDF oder als Plakat erhältlich.



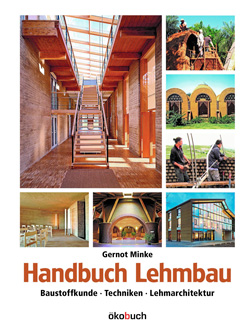

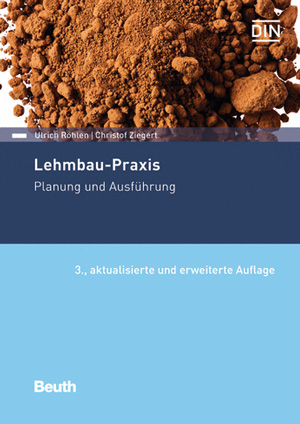
0 Kommentare