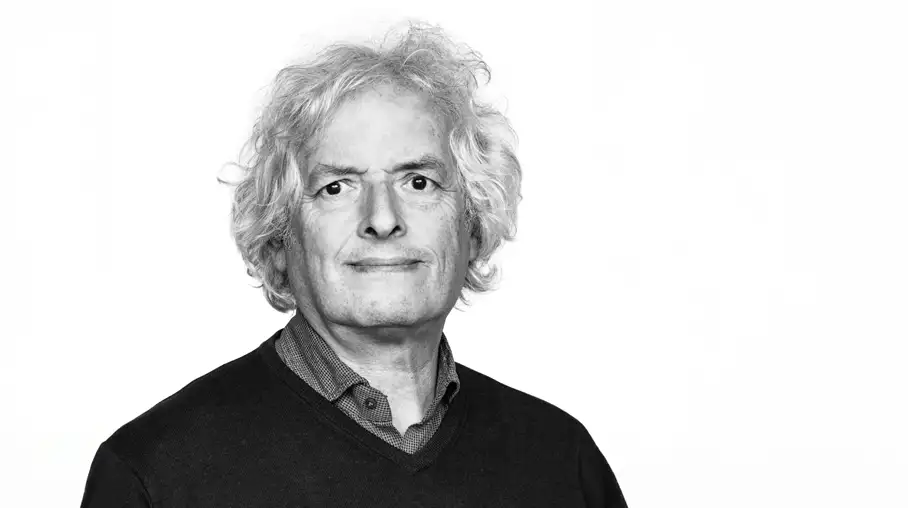
Zukunft des Lehmbaus – Interview mit Martin Rauch
Guten Tag Herr Rauch. Obschon der Stampflehmbau zu den ältesten Bauweisen der Menschheitsgeschichte zählt und wie kaum ein anderer nachhaltige Kriterien erfüllt, findet er in unseren Breiten bis dato immer noch zu wenig Anerkennung. Mit und in der Werkhalle Erden soll sich das ändern. Wo steht die Bauweise heute und wohin kann/soll die Reise gehen?
Das Prinzip der Vorfertigung in einer linearen Schalung mit Verdichtungsmaschine nutzen wir seit 10 Jahren und haben damit mehrere ökonomische und qualitativ hochwertige Großprojekte realisiert. Das Rationalisierungspotenzial ist noch gewaltig und es wäre ein Leichtes, dass weitere Baufirmen dieses Thema aufgreifen. Leider fristet der Stampflehm immer noch ein Nischendasein und die Kostenwahrheit herkömmlicher Baustoffe ist noch nicht gewährleistet. Deshalb ist der ökonomische Druck für große Player in der Baubranche noch nicht hoch genug, diese Bauweise umsetzen. Allerdings ist deren Interesse in den letzten Jahren ist in Anbetracht der CO2-Bepreisung deutlich gestiegen.
Stichwort Regelwerke: Bautechnische Einzelzulassungen gestalten sich lang und aufwendig. Gibt es Ihrerseits Bestrebungen, den Stampflehmbau in die Normen und damit sukzessive auf EU-Ebene in die Eurocodes zu führen?
Mittlerweile konnten wir mehrere Leuchtturmprojekte durch Zustimmung im Einzelfall realisieren. Jede Zustimmung wurde auf Basis der vorhandenen Erfahrung aufgebaut und dadurch ist das Prozedere erleichtert. Hinsichtlich einer Skalierung ist es sicher sinnvoll, eine Norm bzw. eine Bauteilzulassung für Stampflehmbauweisen zu erstellen. Trotzdem sollte aber eine entspr. Norm Innovationen nicht erschweren.
Wie lautet der aktuelle baurechtliche Stand im Stampflehmbau hinsichtlich der Anforderungen an Statik, Luftdichtheit, Schall- und Brandschutz, woran dürfen/ können sich Fachleute orientieren?
Es ist richtig, dass manchmal die bauphysikalischen Themen bei den Lehmbauweisen schwieriger sind als die statischen Voraussetzungen oder Möglichkeiten. Und zwar deshalb, weil die Forschung in dieser Hinsicht noch nicht weit genug fortgeschritten ist und die entsprechenden Parameter für die Berechnungen noch nicht ausreichend vorhanden sind oder wie gewünscht vorhanden sind. Die Qualitäten des Lehmbaus in Bezug auf Brandschutz, Raumklima und Akustik werden allgemein als sehr positiv bestätigt. Aber eben noch nicht ausreichend zertifiziert.



Die Zeiten hoher Baukosten, sich verknappender Rohstoffe, steigender Energiepreise (Stichwort: graue Energie) und CO₂-Besteuerung müssten dem Stampflehmbau zugutekommen. Wie lassen sich dessen Qualitäten sprichwörtlich auf den Boden bringen, und welche politisch-regulatorischen Stellschrauben sind hierzu entscheidend?
Im Vergleich zu Beton – also, wenn man diesen durch Stampflehm ersetzt – verursacht das mindestens 25-mal weniger CO2 Emissionen. Jedoch sind der Arbeitsaufwand und die Kosten des Stampflehms aufgrund des hohen menschlichen Inputs um ca. 30 % teurer. Das heißt da ist die Schmerzgrenze noch zu gering und eine steuerregulierende Maßnahme würde dem Stampflehm oder den Lehmbauweisen sicher zum Durchbruch verhelfen. Ehrliche Kostenwahrheit zu benennen wäre in dieser Hinsicht sehr hilfreich.
Wo liegen bezüglich dem Transport von vorgefertigten Stampflehmteilen aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht die Grenzen?
Diese Situation betrachten wir immer individuell. Im Wesentlichen versuchen wir nicht das Baumaterial zu transportieren, sondern vor Ort die Werkzeuge und das Know-how zu vermitteln. Aus dieser Überlegung hat sich das Thema der „Feldfabrik“ bewährt und in Zukunft möchten wir in Richtung Feldmaschine Know-how entwickeln, das heißt, dass eine Maschine direkt auf der Baustelle die Lehmelemente herstellt und unmittelbar verbaut.
Der Holzbau hat in den letzten Dekaden viel Pionierarbeit geleistet, um sich aus einer Nische über serielle, geprüfte und genormte Bauteile mit Bauvolumina von heute 20 % am gesamten Baugeschehen erfolgreich positionieren zu können. Holz und Lehm verbindet eine uralte Baupartnerschaft. Gibt es Parallelen und Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann, z.B. in Kooperationen mit Zimmereien oder größeren Holzbaubetrieben, die den Stampflehmbau in hybriden Bauwerken in die Fläche bringen könnten?
Die Verbindung zwischen Holz und Lehm hat ein riesiges Potenzial, weil Holz und Lehm sich super ergänzen. Holz hat eine hohe Zugspannung und Tragfähigkeit, die rohe Erde hat eine hohe thermische Speicherfähigkeit, positive raumklimatische Eigenschaften und einen hervorragenden Brandschutz. In der Vergangenheit hat sich im Projekt Hortus gezeigt, dass diese Verbindung im großen Stil umgesetzt werden kann. Seit mehreren Jahren suchen wir dazu den Kontakt zu den Holzbauern. Wenn wir es schaffen, Zimmerer, Architekten und Lehmbauer noch enger zusammenzuspannen, bin ich optimistisch für die Zukunft. Ein wichtiger Schritt dazu ist die Bauwende, ein Verein, der sich für die Förderung von nachhaltigem und zukunftsorientiertem Bauen einsetzt.
Vielen Dank für das Interview Herr Rauch!
Ihre Stimme zählt
Kommentarregeln:
Wir sind neugierig, was Sie zu sagen haben. Hier ist Raum für Ihre Meinung, Erfahrung, Stellungnahme oder ergänzende Informationen. Bitte beachten Sie bei Ihrem Kommentar folgende Regeln:
- Bitte keine Fragen: Auf dieser kostenlosen Informationsplattform können wir keine Fragen beantworten - bitte stellen Sie Ihre Fragen direkt an unsere Autor*innenAutor*innen.
- Bitte keine Werbung: Gerne können Sie auf Ihre Produkte/Dienstleistungen mit einem Werbebanner aufmerksam machen.
2 Kommentare
Einen Kommentar abschicken

Wie werde ich
Baubiolog*in IBN?
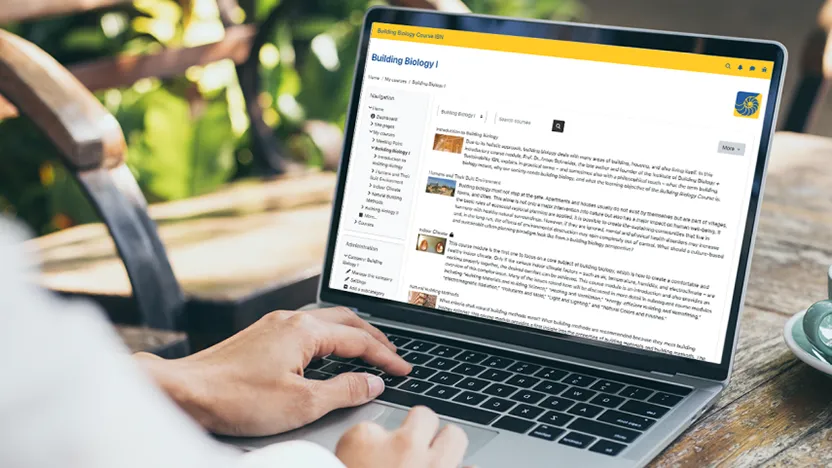
How to become a Building Biology Consultant IBN?
Nachhaltig weiterbilden
Know-how, Zusatzqualifikationen und neue berufliche Möglichkeiten für Baufachleute sowie alle, die sich für gesundes, nachhaltiges Bauen und Wohnen interessieren.
Unser Kompetenz-Netzwerk
Hier finden Sie unsere qualifizierten Baubiologischen Beratungsstellen und Kontakte im In- und Ausland nach Standort und Themen sortiert.
Über die Baubiologie
Die Baubiologie beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Menschen und ihrer gebauten Umwelt. Wie wirken sich Gebäude, Baustoffe und Architektur auf Mensch und Natur aus? Dabei werden ganzheitlich gesundheitliche, nachhaltige und gestalterische Aspekte betrachtet.
25 Leitlinien
Für einen schnellen, aufschlussreichen Überblick haben wir in 25 Leitlinien der Baubiologie die wichtigsten Parameter herausgearbeitet, sortiert und zusammengefasst. In 15 Sprachen, als PDF oder als Plakat erhältlich.

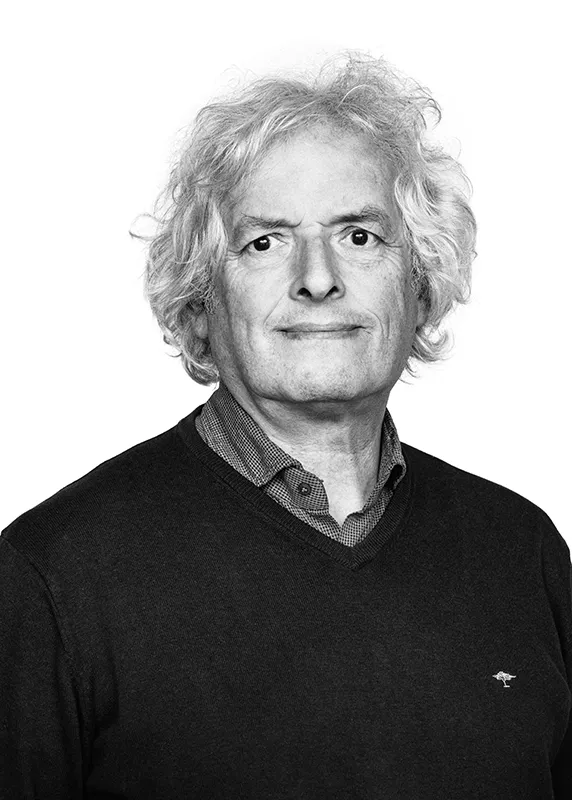

Hallo Herr Lennartz,
gut, dass Sie die kritische Frage nach dem Transport der schweren Bauteile gestellt haben. Das ist meiner Meinung nach ein Knackpunkt. Ein weiterer ist die beschränkende Handwerklichkeit. Der Rückschlag der Stampfer macht die Handwerker schnell mürbe.
Schade, dass Rauchs Antwort sehr unkonkret ist. Immerhin hat er ja lokal eine Fabrik aufgebaut, die möglichst viel produzierem möchte.
Ihnen viel Erfolg weiterhin.
MfG, Achim Pilz
Um den Lehmbau nach vorne zu bringen, dürfen im Sinne des Kunden die Kosten nur geringfügig höher sein als zum Beispiel beim Holzriegelbau.
Ich plädiere für eine Variante der vorgefertigten Wände (in Anlehnung der Holzständerbauweise).
Da bedingt sicherlich Kompromisse zum eigentlichen Stampflehmbau, doch wäre das für mich als Vertriebler eine Marktchance.