Barrierefreier Dachausbau im Denkmal
Die Villa in Brackenheim bei Heilbronn war 1905, der Zeit des des späten Jugendstils in einem historisierenden Stil mit viel Liebe zum Detail erstellt worden. Sie hat ein expressives Sichtfachwerk oberhalb des massiven Erdgeschosses, schlanke Fenster, reich verzierte Erker, ein bewegtes Dach und eine Remise gegenüber. Sie beherbergte eine Arztpraxis, eine Wohnung und zwei kleine Bediensteten-Zimmern unter dem Dach. Seit 1919 gehört sie der Familie Daniel. Bis in die 1960er Jahre wurde das zweigeschossige Dachgeschoss als unbeheizte Bühne genutzt. Dann zog Wolfgang Daniel dort als Jugendlicher ein. Nach Lehr- und Wanderjahren als Landschaftsarchitekt kam er mit seiner Frau, Elisabeth Kemmler-Daniel – Gärtnermeisterin – wieder zurück und zog 1990 in die ausgebaute Remise gegenüber. Bis 2022 wohnten sie dort auf 200 m². Ihre Kinder waren schon ausgezogen, die Wohnung zu groß, so dass sie diese in der Familie weitergaben und sich noch einmal auf das Abenteuer Bauen einließen. Fürs Alter wollten sie sich das Dachgeschoss der Villa zu einem barrierefreien Domizil ausbauen. In der Wohnung der Villa wohnte damals Wolfgangs Mutter, in der ehemaligen Arztpraxis seine Schwester.

Zustand des 120 Jahre alten Denkmals vor dem Umbau, in dessen Zuge auch die Glasbausteine zurückgebaut und die Fenster erneuert wurden
Frühe Entwurfszeichnung des Bauherren
Unterkonstruktion für den neuen Aufzug, die in das Vordach im EG eingefädelt wurde4 Familie Daniel baute das Dachgeschoss mit einem neuen Aufzugturm barrierefrei aus
Familie Daniel baute das Dachgeschoss mit einem neuen Aufzugturm barrierefrei aus1 Zustand des 120 Jahre alten Denkmals vor dem Umbau, in dessen Zuge auch die Glasbausteine zurückgebaut und die Fenster erneuert wurden
2 Frühe Entwurfszeichnung des Bauherren
3 Unterkonstruktion für den neuen Aufzug, die in das Vordach im EG eingefädelt wurde
4 Familie Daniel baute das Dachgeschoss mit einem neuen Aufzugturm barrierefrei aus
Planen mit dem Denkmalamt
Für eine barrierefreie Erschließung und die Nutzung des Dachgeschosses entwarfen sie auf der Westseite der Villa einen Aufzugsturm mit Außenerschließung für alle Geschosse durch Treppen- und Balkonanlage im Hof und eine bessere Belichtung der Dachwohnung. Für Dachausbau und Turm war eine Baugenehmigung nötig. Als sie diese beim Planungsamt nachfragten, stellte sich überraschend heraus, dass die Villa Denkmalstatus hatte. Überraschend, denn beim Ausbau der Remise vor 30 Jahren hatten sie einen Antrag gestellt, die Villa unter Denkmalschutz zu stellen – mit ablehnendem Bescheid. Sie war erst 1997 in die Landesdenkmaliste aufgenommen worden. Mit dem Denkmalstatus waren Abstimmungen mit der Denkmalbehörde nötig, welche die Planung erst einmal nicht freigab. „Sie wollten, dass wir den Umfang der neuen Flächen reduzieren“, erinnert sich Elisabeth Kemmler-Daniel und ihr Mann ergänzt: „Durch den Widerstand haben wir noch einmal nachgedacht und tatsächlich reduziert.“
Ein Kritikpunkt war der Nachbau der Fenster in den Giebeln. Das Amt wollte Kreuzsprossen in den hochformatigen Öffnungsflügeln. „Die hat es aber noch nie gegeben“, ärgert sich der Bauherr. „Denkmalschutz finde ich sehr wichtig. Aber die Vorgaben müssen überlegt sein.“Und so ließ er die neuen Fenster nach den Originalen bauen. „Wir haben alles denkmalgerecht gemacht“, betont er. „Im Ganzen war der Austausch sehr fruchtbar“, fasst es seine Frau zusammen.
Erneuerbar heizen
Hilfreich waren auch die Tipps vom Baubiologen IBN und Denkmalexperten Dipl. Ing. Rolf Canters von Bau Plusenergie im Rahmen der von der KfW geförderten Baubegleitung. Der Energieberater Canters war ihnen von Peter Steinhausen empfohlen worden, Lieferant der ökologischen Baustoffe und ebenso Baubiologe IBN. Er bestätigte sie auch darin, einen Holzofen einzubauen. „Ein Holzofen sorgt bei Betrieb über die Raumluft für zusätzlichen Luftwechsel und entfeuchtet“, betont Canters. Zudem erhielten alle senkrechten Wände Wandheizungen, Bad und Küche Fußbodenheizung, alles wassergeführt, versorgt durch eine bestehende Gas-Zentralheizung. „Wir haben die Wandheizung noch nie angeschaltet“,amüsiert sich der Hausherr. Der Heizeinsatz des Ofens mit 9 KW genügt für die 120 m². Im letzten Winter heizten sie ausschließlich mit Holz und benötigten dafür 4 – 5 Raummeter.

Der Bauherr beim Bearbeiten der Ecksteine ...
… und beim Montieren der Wandheizung
Der neue Balkon ist mit halbtransparenten Photovoltaikmodulen überdacht
In luftiger Höhe, zwischen Aufzugturm und neuem Eingang fanden Gärtnermeisterin und Landschaftsarchitekt noch Platz für zwei Pflanzbeete5 Der Bauherr beim Bearbeiten der Ecksteine …
6 … und beim Montieren der Wandheizung
7 Der neue Balkon ist mit halbtransparenten Photovoltaikmodulen überdacht
8 In luftiger Höhe, zwischen Aufzugturm und neuem Eingang fanden Gärtnermeisterin und Landschaftsarchitekt noch Platz für zwei Pflanzbeete
Ökologische Dämmung
Das Dach mit den drei Giebeln dämmten Daniels von innen mit Holzfaserplatten mit einem Spalt unter den Ziegeln für die Hinterlüftung. „Das ist eine komplexe Dachform“, betont der Energieberater . „Deshalb sind wir nicht von außen ran.“ Zum Glück waren die 120 Jahre alten Dachziegel noch gut erhalten, so dass sie liegen bleiben konnten. Nur die Kehlbleche wurden gestrichen. Eine feuchtevariable Dampfbremse ermöglicht, dass die Holzkonstruktion nach innen rücktrocknet.
Die ausgemauerten Fachwerkgiebel und die Drempel erhielten von innen einen Kalk-Dämmputz, den Wolfgang Daniel auf lotrecht angebrachten Latten abzog. Darauf klebte er dünne Holzfaserdämmplatten mit Nut und Feder in Lehm und setzte zudem Dübel. Diese Flächen – gut 50 m² – belegte er mit Wandheizleitungen und überputzte sie mit einem Kalk/Lehmputz mit Hanffasern. „Der Lehm erleichtert die Verarbeitbarkeit, weil der Putz nicht so schnell anzieht. Außerdem verbessert er den Feuchteaustausch im Wandaufbau und somit das Raumklima merklich“, erklärt der Baubiologe. Anschließen verputze der Bauherr alle Flächen mit einem armierten Kalk-Feinputz und strich zum Abschluss eine Sumpfkalkfarbe.
Zur Bühne hin dämmen heute als Putzträger unter den Deckenbalken Holzweichfaserplatten und zwischen den Balken Hanfdämmmatten. Auf den vorhandenen Dielenboden kamen Kanthölzer, mineralisierte Holzspäne und Holzweichfaserdämmplatten. Der neue Dielenbelag ist aus Lärchenholz. Auch bei Sommerhitze ist die Dämmung mit wärmepuffernden Materialien sehr zufriedenstellend.
Photovoltaik am Denkmal
Energieberater Canters fand einen wirtschaftlich sinnvollen Platz für die Photovoltaikmoduleauf dem gläsernen Vordach über dem Balkon im 1.OG. „Wie haben uns darauf berufen, dass die transparenten Module von der Straße nicht einsehbar sind“, erklärt er auf die Frage, ob die Bewilligung schwierig war.


Giftige Holzschutzmitteln im Dachtragwerk bestätigte die Analyse einer Materialprobe. Baufamilie Daniel maskierte die Hölzer mit Schellack
Alles ist heute barrierefrei für das Wohnen im Alter vorbereitet9 Kalkputz, Wandheizungen, ein Grundofen und differenziertes Kunst- sowie Tageslicht erzeugen ein angenehmes Raumgefühl
10 Giftige Holzschutzmittel im Dachtragwerk bestätigte die Analyse einer Materialprobe. Baufamilie Daniel maskierte die Hölzer mit Schellack
11 Alles ist heute barrierefrei für das Wohnen im Alter vorbereitet
Viel Eigenleistung
Der Umbau begann 2020. Mit Hilfe der Familie übernahm das Ehepaar viele Gewerke. „Wir haben fast alles selbst gemacht“, erzählt der Bauherr stolz. So mauerte er auch den Aufzugsturm selbst und schnitt in den Sandstein für die Ecksteine Gesichter, Sonne, Mond und Tiere. Zusammen zogen sie neue Wände ein, legten Wandheizleitungen, sanierten Bäder, inklusive der neuen Elektroverkabelung und dämmten das Dach. Mehr als 5.000 h Eigenleistung flossen in das Projekt.
Ein Zimmerermeister kam, um die Gauben und die Turmhaube aufzuschlagen. Auch die Elektroanschlüsse führte ein Meisterbetrieb aus. Ebenso den Ausbau des Bades – incl. Anschluss der Toiletten an eine 21m³ Regenwasserzisterne – und Setzen des Ofens. Das meiste führten die Bauherren aus, auch die Schadstoffsanierung.
Schadstoff-Maskierung
Altbauten sind oft mit Schadstoffen belastet, so auch hier. In den Konstruktionshölzern gab es
keine Ausfluglöcher des Hausbocks, dafür Bohrlöcher mit Pfropfen für das Insektengift. Es fand sich auch eine Rechnung über „Kampfmittel“ von 1954. Baubiologe Canters schickte eine Mischprobe aus Holzspänen ins Labor. Die Holzschutzmittelanalyse mit einem Scan auf die 16 wichtigsten Wirkstoffe bestätigte eine sehr hohe Belastung an PCP sowie Spuren von Lindan und Dioxinen. Deshalb strichen die Eigentümer, geschützt durch Atemmasken, alle Balken mit Schellack, der die Gifte weitgehend absperrt. „Außerdem haben wir uns entschieden, die meisten Hölzer zu verkleiden“, berichtet Elisabeth Kemmler-Daniel. „Nur, wo es nicht anders ging, haben wir sie sichtbar gelassen.“
Auch im Keller gab es Schadstoffe. Dort waren die Hölzer der Abtrennungen mit damals PCP-haltigem Xyladekor gestrichen gewesen. Sie wurden ebenso wie die Dachpappe eines Flachdachs, die Asbest enthielt, mit Schutzausrüstung ausgebaut, verpackt und ordnungsgemäß entsorgt. „Das hat ein Haufen Geld gekostet“, bestätigt die Baufrau.
Mehr Licht
Für ausreichend Licht sorgen vier vergrößerte Dachflächenfenster sowie zwei neue Gauben. Eine liegt über dem Treppenhaus, die andere Richtung Turm, mit dem sie über eine Terrasse verbunden ist. Dort ist auch der neue barrierefreie Eingang. Die neu gebauten Fenster in den vier Giebeln erhielten für besseren Durchblick einen etwas höher liegenden Kämpfer. „Wir sind extrem zufrieden“, freut sich der Hausherr. „Alles funktioniert hervorragend.“
Baudaten
Barrierefreies Denkmal in Brackenheim
| Baujahr | 1905 |
| Sanierung | 2022 |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Baufamilie | Elisabeth Kemmler-Daniel, Wolfgang Daniel |
| Außenwände (von außen nach innen) | Fachwerk mit zementgebundenem Bimssteinen, Kalk-Dämmputz, Wandheizung, Lehmkleber, Holzhartfaserplatten, Kalkputz, Kalkfarbe. Bzw. bestehendes Dach mit Holzfaserdämmung zwischen und unter den Sparren, Dampfbremse, Kalkputz, Kalkfarbe. |
| Heizsystem | Holzofen sowie bestehende Gastherme für Wandheizung |
| Photovoltaik | 1,8 KWp, semitransparent im Glasvordach |
| Eigenleistung | 5.000 h |
| Planung | Wolfgang Daniel |
| Energieberatung, Baubegleitung | Rolf Canters, www.bauplusenergie.de |
| Materiallieferung | Peter Steinhausen, www.steinhausen-naturbau.de |
Ihre Stimme zählt
Kommentarregeln:
Wir sind neugierig, was Sie zu sagen haben. Hier ist Raum für Ihre Meinung, Erfahrung, Stellungnahme oder ergänzende Informationen. Bitte beachten Sie bei Ihrem Kommentar folgende Regeln:
- Bitte keine Fragen: Auf dieser kostenlosen Informationsplattform können wir keine Fragen beantworten - bitte stellen Sie Ihre Fragen direkt an unsere Autor*innenAutor*innen.
- Bitte keine Werbung: Gerne können Sie auf Ihre Produkte/Dienstleistungen mit einem Werbebanner aufmerksam machen.

Wie werde ich
Baubiolog*in IBN?
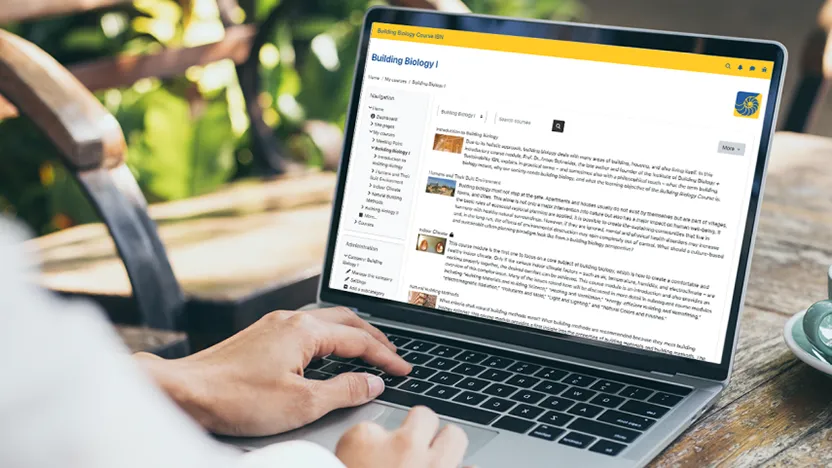
How to become a Building Biology Consultant IBN?
Nachhaltig weiterbilden
Know-how, Zusatzqualifikationen und neue berufliche Möglichkeiten für Baufachleute sowie alle, die sich für gesundes, nachhaltiges Bauen und Wohnen interessieren.
Unser Kompetenz-Netzwerk
Hier finden Sie unsere qualifizierten Baubiologischen Beratungsstellen und Kontakte im In- und Ausland nach Standort und Themen sortiert.
Über die Baubiologie
Die Baubiologie beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Menschen und ihrer gebauten Umwelt. Wie wirken sich Gebäude, Baustoffe und Architektur auf Mensch und Natur aus? Dabei werden ganzheitlich gesundheitliche, nachhaltige und gestalterische Aspekte betrachtet.
25 Leitlinien
Für einen schnellen, aufschlussreichen Überblick haben wir in 25 Leitlinien der Baubiologie die wichtigsten Parameter herausgearbeitet, sortiert und zusammengefasst. In 15 Sprachen, als PDF oder als Plakat erhältlich.



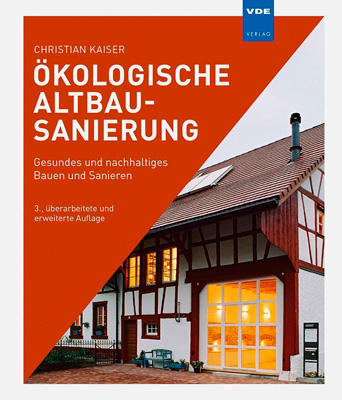
0 Kommentare